Dr. Hans Henry Richter
Der erste Weltkrieg war noch nicht ausgebrochen, als ich an einem
Sonntag,
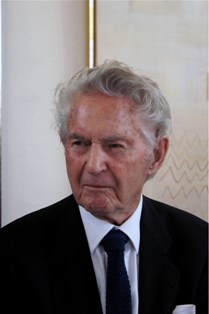
dem 24. Dezember 1911, in Berlin zur Welt kam.
Mein Vater war Konzertmeister und ein Virtuose auf der Geige und dem Klavier, mit einer in Russland begonnenen beachtlichen Karriere und Engagements in St. Petersburg, Hamburg, Berlin u.a.m.
Meine Mutter, zweitälteste von sechs Geschwistern, wurde
sozusagen auf der Durchreise in Leuve St. Pierre, in Belgiern geboren.
Mein Großvater war Porzellanmaler, zog mit seiner Familie von Manufaktur
zu Manufaktur, entwarf neue Muster und lernte die Kollegen in der
Ausführung an. So kamen seine Kinder in einer immer neuen und auch
fremden Umgebung zur Welt.
Meine Mutter sprach Französisch besser als Deutsch, durfte aber in einer
nationalistisch eingestellten politischen Welt keinen Gebrauch davon
machen.
Mein Vater musste nach dem ersten Weltkrieg häufig sein
Engagement wechseln. Dann nahm meine Mutter mit mir Zuflucht bei ihren
Geschwistern in Schlesien. So kam es, dass wir beide oft monatelang
unsere Wohnung in Mühlhausen in Thüringen mit dem Gutshof und Hotel
ihres Bruders im niederschlesischen Bergland tauschten.
Im Jahre 1931 bestand ich am Realgymnasium in Mühlhausen das Abitur, ein
mit den Realien nicht besonders vertrauter Schüler, der aber in Zeichnen
und Kunstgeschichte in der Prima dominierend, mit seiner Darlegung der
Stilentwicklung in Malerei und Plastik das gesamte Lehrerkollegium bis
in den späten Abend des letzten Prüfungstages zu fesseln wusste.
Ich entging damit der nochmaligen Wiederholung der Prima und konnte den
mit farbigen Bändern geschmückten Lorbeerkranz auf meiner weißen
Primanermütze befestigen.
Ich hatte vor, es mit dem Architekturstudium zu versuchen und
ging nach Berlin, um mich an der Technischen Hochschule einschreiben zu
lassen. In der mir fremden und voll Unruhe erfüllten Stadt waren
allerdings bald meine mehr als geringen materiellen Reserven verbraucht.
Trotzdem war es wohl ein eigensinniger Stolz, der mich die drei Monate
des Semesters durchhalten ließ. In der vorlesungsfreien Zeit lief ich
oft viele Kilometer, um die Straßen Berlins hinter mich zu lassen und
etwa am Ufer der Havel in der Sonne zu liegen oder auch um am Rande der
Stadt am Tisch meines Vetters einmal richtig zu essen und zu trinken.
Mein Vetter war Kleistpreisträger und bekannter Schriftsteller. Er war es, der mich mit der großen Literatur bekannt machte und mich veranlasste, in der Abgeschiedenheit meines Berliner Zimmers die Welt eines Flaubert oder eines Honoré de Balsac kennen zu lernen, um mit ihren Helden zu leiden, die oft an einer mitleidlosen Gesellschaft zugrunde gingen.
Nach dem Berliner Semester "trampte" ich nach Schlesien.
Ein schöner Sommer, eine herzliche Aufnahme bei den Geschwistern meiner
Mutter und die vertraute Umgebung ließen mich das Berliner Abseits
schnell vergessen.
Im August 1931 ging ich in das von mittelalterlichen Mauern und Türmen
bewehrte Mühlhausen zurück. Bis in den Winter hinein hoffte ich, durch
meinen Vetter Gerhard, der in Berlin einflussreiche Leute in der
Medienbrache kannte, im Journalismus unterzukommen.
Als dies immer unwahrscheinlicher wurde, da die in
Deutschland zunehmende wirtschaftliche Schwäche und politische
Ungewissheit jedes sichere längerfristige Planen auch bei den Freunden
infrage stellte, nahm ich ein, an mich herangetragenes Angebot an und
begann eine Lehre als Steinmetz und Bildhauer.
Im Jahre 1935 schloss ich die Lehre mit der Gesellenprüfung ab und
begann eine Weiterbildung bei den Akademischen Bildhauern Walter Krause
in Mühlhausen - Meisterschüler von Adolf von Hildebrand - und Dubois in
Raspenau in Niederschlesien.
Ein glücklicher Zufall wollte es, dass in diesem kleinen Dorf Raspenau
an der tschechischen Grenze der Parteiapparat nicht vorhanden war.
Lebte ich doch in einem Deutschland, in dem ein so genannter Führer an
die Macht gekommen war, dessen Parteiapparat anders denkende Menschen
oder solche, die seinem krankhaften Idealbild nicht entsprachen,
ausgrenzte oder gar vernichtete, wo sein Einfluss sie erreichte.
Doch in Raspenau konnte ich, entsprechend dem Anwachsen meiner
finanziellen Rücklagen, ganz ohne parteiliche Einmischungen Pläne für
meine Zukunft entwerfen.
Im Sommer 1937 verließ ich meine politische Oase und immatrikulierte mich als Student der Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. 1938 ging ich für ein Semester nach Berlin. Mein Antrag, an der Universität Genf mein Studium fortsetzen zu dürfen, wurde genehmigt, und so fuhr ich nach Abschluss des Wintersemesters, am 18. April 1939, mit einer kleinen Gruppe deutscher Studenten über den Grenzort Thayngen in die Schweiz. Am gleichen Abend erreichten wir Genf.
Ich betrat an diesem Abend ein für mich ganz unbekanntes
Land. Seine Wirklichkeit verbarg sich noch hinter seinem geschichtlichen
Bild.
Ich hatte mich mit Calvin und Rousseau beschäftigt. Der eine ein von
Gottes Auftrag erfüllter Reformator, der - wie Balzac schrieb - alle
Gräuel Robespierres vorweg genommen hatte. Seine Herrschaft dauerte
zwanzig Jahre, die Prägung durch seine sinnenfeindliche Lehre, die
materiellen Erfolg als Gottesgnadentum erkennt, währt bis heute.
Der andere, Rousseau, ein wirklicher Sohn der Stadt, hatte die Lehre von
dem, von Natur aus guten Menschen entwickelt, welche die Revolutionen
der folgenden Jahrhunderte inspirieren sollte.
Mochte sich auch noch ein Rest moralischer Strenge hinter den Fassaden
der alten Bürgenhäuser verbergen, alles wurde aufgelockert durch ein, in
Bürgerfreiheit geübtes waches, zuvorkommendes Verhalten, das mir jede
Begegnung zu einem Gewinn machte, auch durch die Fröhlichkeit der
spielenden Kinder und die zarte Schönheit, den Charme und den Esprit der
jungen Töchter der ›Republik‹, denen nicht nur ich allzu schnell
verfiel.
Die Straßen und Plätze, die Wiesen und Weinberge, der Lac Léman, dessen
Licht alles überstrahlte, die Räume, in denen sich meine Begegnungen
vollzogen, all das gewann mich mit betörender Kraft.
War ich damals doch nur vorübergehend entlassen aus einer
nationalistischen Welt, die mich ganz für sich wollte. Hier fand ich
eine Welt, die keine Forderungen an mich hatte, mir überdies etwas
kostbares anbot: das Abenteuer Freiheit.
Wie zerbrechlich dieses war, erfuhr ich zum Ende des Sommersemesters,
als wir deutschen Studenten zum Ernteeinsatz bei Zoppot in der Nähe von
Danzig befohlen wurden, um unseren Dank für die Genfer Freiheit
abzuleisten.
In Berlin konnte ich den unheilvollen Tag der Kriegserklärung an Polen
miterleben. Der 1. September 1939 war ein heißer, dunstiger Tag, und das
Brandenburger Tor leuchtete in einem rot glühenden Sonnenuntergang.
Berlin blieb stumm, ohne Anzeichen irgendeiner Begeisterung.
Ich wurde gemustert, für kriegstauglich befunden und zurückgestellt. Man
brauchte mich noch nicht in dem Spiel eines Besessenen, der die Welt
seiner hirnverbrannten Idee unterwerfen wollte.
Erneut erhielt ich das Einreisevisum in die Schweiz, um mein Studium
fortzusetzen. Noch einmal durfte ich in eine Stadt, in der die Lichter
noch nicht ausgegangen waren.
Als ich am 15. März 1940 Genf nach zwei Semestern verließ, hatte ich begriffen, was mir diese kurze Zeit geschenkt hatte. Es sollten mehr als fünf Jahre vergehen, ehe ich wieder einen Schritt dem Abenteuer Freiheit entgegentun konnte.
Kurz bevor ich Genf verließ, kam es zu einer Begegnung, wie sie
damals in Genf offenbar möglich war. Nach einem Vorgespräch mit einem
ungarischen Studenten und mit Zustimmung von Generalkonsul Krauel traf
ich mich in einem Café der "Commune de Carouge" mit einem Engländer, der
als Erkennungszeichen einen Drahthaardackel mit sich führte. Er bat,
sich an meinen Tisch setzen zu dürfen und übergab mir ein Paket mit
Geheimdokumenten der britischen Regierung - angeblich zur Sondierung von
Geheimgesprächen über einen möglichen Waffenstillstand - zur
Weiterleitung an die Reichsregierung. Das sollte mir noch einigen Ärger
bereiten.
Nun begrüßte ich damals alles, was ungewöhnlich war und mich über die
Vorlesungen hinaus beschäftigte. Doch waren mir die Praktiken noch
nicht geläufig, mit denen die willfährigen Schergen des Dritten Reiches
all jene bedachten, die der Obrigkeit verdächtig wurden. Mit dem Empfang
und der Weitergabe jenes Paketes wurde ich zu einem Kandidaten für die
Mühlen, in der Unbotmäßige zermahlen wurden.
Am 14. März 1940 verließ ich die Schweiz wieder mit Reiseziel
Berlin. Versehen mit den guten Wünschen von Generalkonsul Krauel hatte
ich mich in dem berüchtigten Gebäude des SD-Hauptamtes in der
Bendlerstraße einzufinden.
Ich wurde in das Büro eines höheren SS-Offiziers geführt. Noch heute
stehe ich unter dem Eindruck des tragischkomischen Widerspruches
zwischen den Phrasen, die dieser Mensch schreiend an mich richtete, und
der Eleganz, die sowohl seine Kleidung als auch die Einrichtung des
Raumes auszeichnete.
Er war in seinen Ausdrücken nicht wählerisch, deren Sinn offenbar darin
lag, mich ob meiner Kühnheit ›fertig zu machen‹. Offenbar hatte ich
etwas getan, das mir keinesfalls zustand. Seine Ausführungen machten
klar, dass an meinem Deutschtum zu zweifeln war.
Zu meinem Glück war ich bereits gemustert, und bis in die
Kommandostellen der Wehrmacht reichten die Befugnisse der SS noch nicht.
Daher wurde mir anheim gestellt, meine angeblich verloren gegangene Ehre
im Einsatz an der Front zurück zu gewinnen.
So begann einen Monat später, am 15. April 1940, meine
Laufbahn als Soldat.
Meine Ausbildung begann bei einer ›Intelligenztruppe‹, wie der mich in
Heidelberg, wo inzwischen weiter studierte, auswählende Major
versicherte. Es handelte sich um die 2. Nebel-Ersatz-Abteilung in
Bremen.
Die zwei Monate der Grundausbildung erforderten in der Tat eine
besondere Art von Intelligenz. Sie wurde notwendig, um die körperliche
Herausforderung bei der Handhabung eines schweren Granatwerfers -
unserer Waffe - zu kompensieren.
Nach der Grundausbildung wurden wir vorübergehend entlassen. Ich nutzte
die Zeit, um mein Studium der Volkswirtschaftslehre in Heidelberg
abzuschließen und bestand das Examen mit ›gut‹.
Bis zum 21. Juli 1941 erfolgte in einer norddeutschen Kaserne die
theoretische und praktische Ausbildung für den Einsatz an der Front.
Nach Ausrüstung mit einer neuen Werfergeneration fuhren wir nach
Frankreich in die Normandie zum Küstenschutz am Ärmelkanal. Wir bezogen
Quartier in Tancarville in einem Schloss direkt an der Seine. Da der
Krieg mit Frankreich beendet war, diente unser Aufenthalt offenbar nur
zur Einstimmung auf andere Aufgaben. Drei Monate später erfolgte unser
Abtransport in den Russlandfeldzug.
Als Heeresartillerie wurden wir bei so genannten Durchbrüchen und
Verfolgungen an den Brennpunkten eingesetzt, bis wir die Krim erobert
ujnd schließlich Sewastopol eingenommen hatten. Anschließend ging es
weiter in den Kaukasus, wo wir zuletzt in einem kabardinischen Bergdorf
Quartier bezogen. Soweit es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam,
war es meine Aufgabe, als B-Offizier oder vorgeschobener Beobachter das
Feuer unserer Granatwerfer zu leiten.
Ende 1942 wurden für das Afrika-Chor ein Wachtmeister, ein Unteroffizier
und acht Soldaten angefordert. Mein Batterie-Führer benannte mich und so
fuhr ich mit dem Unteroffizier und den Soldaten quer durch Russland bis
nach Munsterlager in der Lüneburger Heide.
Zum ersten Mal bekam ich Urlaub. Weihnachten verbrachte ich bei meinen
überglücklichen Eltern in Mühlhausen in Thüringen und fuhr dann nach
Heidelberg. Das Neue Jahr begrüßte ich bei einem Tanz bis in den Morgen
auf unserem Haus vom Chor Schwaben. Das Ergebnis: ein bösartiger
Kniefurunkel, Meldung beim Standortarzt und umgehende Operation in der
Chirurgischen Klinik in Heidelberg. Bei der gründlichen medizinischen
Untersuchung wurden neben Ruhr auch andere bedenkliche Symptome
festgestellt, die an der Ostfront als normal, hier in der Heimat aber
als ernste Krankheiten galten, und aufgrund derer ich erst im Februar
1943 aus der Klinik entlassen und zu einer Einheit nach Verden an der
Aller befohlen wurde. Dort richtete ich aufgrund meiner Erfahrungen in
Russland ein so genanntes Wintermuseum ein und wurde im Oktober 1943 mit
der Leitung eines Lehrgangs für Reserve-Offiziersbewerber betraut. Ich
vergatterte meine Unteroffiziere: Bei der Ausbildung auf dem Kasernenhof
erfolgen keine der üblichen Schikanen. Der Lehrgang wurde ein voller
Erfolg. Sämtliche Teilnehmer wurden zu Unteroffizieren befördert.
Am 21. August 1944 kommt mein Abschied von der Reiterstadt. Mein
Fahnenjunker-Lehrgang beginnt am 22. August in Westfalenhof-Groß Born in
Westpreußen und dauert bis zum 16. Dezember. Beförderungen bleiben nicht
aus: zum Oberfähnrich am 1. November und zum Leutnant am 1. Dezember
1944. Mein Lehrgangsleiter Hauptmann Derfner befreit mich oft von der
Routine des Lehrganges. Als Pilzkenner gehen ich in die Wälder und trage
zur Verbesserung unserer mehr als dürftigen Ernährung bei.
Nach dem Lehrgang fahre ich wieder nach Verden, von wo ich am 15. Januar
1945 nach Posen versetzt werde. Dort ankommen werde ich nicht. Posen ist
bereits in der Hand der Russen.
Der Zug hält mitten in einem Schneesturm in Neutomichel.
Ich suche eine Meldestelle, werde sofort vereinnahmt und bin nun
Mitglied einer Auffangorganisation, die mitb den zurück weichenden
Soldaten einen hinhaltenden Widerstand aufbauen soll.
Nach kurzer Zeit werde ich Ordonnanzoffizier bei dem Befehlshaber der
Organisation, General Schroeck, einem Ostpreußen, der sein schönes Gut
wohl für immer verloren hat. Er schirmt mich gegen alle Versuche ab,
mich für einen anderen Einsatz zu gewinnen.
Der Rückzug ist begleitet von Not, Elend und Tod der mit flüchtenden
Frauen und Kindern besetzten Wagenkolonnen.
Anfang Februar 1945 hatten uns die Russen rechts und links überholt und
bereits die Oder erreicht. Wir entschlossen uns zu einem gefährlichen
Versuch.
Wir befanden uns an einem Bahndamm Richtung Frankfurt an der Oder. Es
war tiefe Nacht, und wir marschierten ohne Gepäck, lautlos, schweigend,
nur mit unseren Maschinengewehren bewaffnet, an den Biwakfeuern vorbei,
die oben auf dem Damm brannten, und kamen unbehelligt über die
Eisenbahnbrücke nach Frankfurt.
Nach einer Übernachtung in einem, von seinen geflüchteten Bewohnern
verlassenen Haus machten wir am nächsten Tag Halt in Hangelsberg bei
Berlin. Von hier wurde das Auffangkommando nach Stralsund beordert.
ich erhalte den irrealen Auftrag, ›die Fahrzeuge nachzuführen‹. Das
beinahe Unmögliche gelingt mit Hilfe der Reichsbahndirektion in Berlin,
einem Pritschenzug, meinem Wachtmeister, meinem Unteroffizier und einem
Eisenbahner.
Auf einer langen Fahrt durch von Menschen verlassenes Gebiet erreichen
wir tatsächlich Stralsund, und ich kann dem verblüfften General den
Vollzug des Befehls melden.
Das Auffangkommando ist wieder motorisiert. Ich werde Auffangkommandant
in Feldberg am Feldsee und in Waren am Müritzsee. General Schroeck hat
mir den Rang eines Majors verliehen, was meinen Aufgaben sehr hilfreich
ist.
Doch nach Feldberg kommt in Waren nur noch ein kurzes Zwischenspiel. Der
Krieg geht zu Ende. Wir merken es daran, dass sich niemand mehr um das
Auffangkommando kümmert.
Als wir nördlich von unserer Meldestelle einen Jeep mit amerikanischen
Soldaten und einer weißen Fahne vorbei fahren sehen, löse ich die
Meldestelle auf und stelle es jedem frei, sich in eigener Verantwortung
zu wenden, wohin er wolle.
Auch mein Weg führte in die Gefangenschaft, zunächst in die
amerikanische und dann in die britische und zwar in ein Gebiet von
Schleswig-Holstein nördlich von Oldenburg. Dort wurde mir die
Verantwortung über eine etwa 150 mann starke Kompanie übertragen. Ich
hatte die Verpflegung zu organisieren und wurde dabei sehr bald mit
einer finsteren Seite des bisherigen Regimes bekannt: Es wurde uns
mitgeteilt, dass unsere Rationen für einige Zeit den gleichen Umfang
haben würden wie in den Konzentrationslagern des Deutschen Reiches.
Ich wurde schließlich als Kfz-Offizier auf das Gut Seegalendorf
versetzt. Hier hatte ich Zeit, über das, was gewesen war und das damit
verbundene grausige Vabanque-Spiel eines Wahnsinnigen nachzudenken mit
der Folge von Millionen Toten Zivilpersonen und Soldaten auf beiden
Seiten und, was vielen von uns Gefangenen zum ersten Mal bekannt wurde:
der systematischen Ausrottung von Menschen jüdischen Glaubens gleich
welcher Nation überall dort, wohin der Einfluss des so genannten Führers
reichte.
Wir, von den Engländern auf dem Gut internierten Gefangenen, versorgten
uns in freier Selbstverwaltung und organisierten in dem wunderbaren
Frühling 1945 Theateraufführungen, Lesungen und Musikveranstaltungen.
Denn unter uns Soldaten waren auch zahlreiche Künstler. Sogar Mathias
Wiemann las uns vor.
Bei einer dieser Veranstaltungen hatte ich die wichtigste Begegnung
meines Lebens. Unter den Gutsleuten saß eine junge Frau, die ich nicht
vergessen konnte. Ich setzte alles daran, sie kennen zu lernen.
Rosmarie wurde später meine Frau. Wir bekamen zwei Wunschkinder, Sohn
Clemens am 13. April 1952 und Tochter Viola am 16. September 1957. Mit
meiner Rosmarie nun seit mehr als 60 Jahren ein von Glück erfülltes
Leben.
Es folgte die Entlassung aus der Gefangenschaft. Was war ich nach diesem Krieg? Ein entnazifizierter Leutnant, ein Steinmetz und Bildhauer mit Gesellenbrief, ein diplomierter Volkswirt, der bald seine Liebste heiratete.
Illegal und abenteuerlich reisten wir durch mehrere
Besatzungszonen nach Walldürn im Odenwald, wo ich als Bildhauer in den
Dienst des dortigen Augustinerklosters trat. Im dessen Auftrag schuf ich
einen großen Freialtar mit dem Zeichen des Heiligen Blutes, zwei Reliefs
für die neuen Glocken der Wallfahrtskirche und ein lebensgroßes Kruzifix
für den Pfarrer der Kirche in Hundheim bei Wertheim am Main.
Mit der Währungsreform verloren die Augustiner die Möglichkeit für
weitere Aufträge und wir kehrten zurück in den Norden. Im Haus meiner
Schwiegereltern an der Kieler Förde konnten wir frei wohnen, ich wurde
wieder Student an der Kieler Universität, besuchte Vorlesungen und nahm
an Übungen teil.
Es folgten im Rahmen eines Forschungsauftrages zusammen mit einem Freund
und Kollegen drei Jahre ›Kärrnerdienste‹. Es ging dabei um die
Verflechtung der Sozialleistungen im Nachkriegsdeutschland und um die
Vorbereitung einer Statistik darüber beim Statistischen Bundesamt. Das
Thema meiner Doktorarbeit lautete in diesem Zusammenhang ›Die
rechtlichen Grundlagen deutscher Sozialpolitk‹.
Mein Kollege und ich bestanden gemeinsam die Prüfung zum Dr. sc. pol.
mit ›summa cum laude‹. Ich hatte nun die Aufgabe, mich mit dem Thema
›Die europäische Sozialpolitik‹ zu habilitieren und war schon auf dem
Weg nach Genf zum Internationalen Arbeitsamt, als mein Professor Dr.
Mackenroth starb.
Da keiner seiner Kollegen in der Lage war, mich zu übernehmen, nahm ich
1955 ein Angebot der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft e.V. in Hamburg
an und wurde Leiter der Vortragsplanung auf dem neutralen Forum der
Gesellschaft. Im Jahr darauf gründeten wir in Bad Harzburg die ›Akademie
für Führungskräfte - middle management‹, die kurz darauf in ›Akademie
für Führungskräfte der Wirtschaft‹ umbenannt wurde.
Neben der wirklich neuen Führungskonzeption der ›Delegation
von Verantwortung‹, die zum Banner der Akademie wurde, umfasste das
Programm, das von mir in Zusammenarbeit mit jungen Assistenten
verschiedener Universitäten angeboten wurde, bald sämtliche Gebiete der
Unternehmensführung.
Im Rahmen meiner Planungsaufgabe entstanden
1. das Ausbildungsprogramm für Meister und Gruppenführer sowie für
kaufmännische und technische Führungskräfte.
2. Ferner initiierte ich das ›Harzburg-Kolleg‹, einen
Zehn-Wochen-Lehrgang, den ich für viele Jahre übernahm. ich konnte an
dem 25-jährigen Jubiläum des ›Harzburg-Kollegs‹ noch teilnehmen.
3. Weiterhin entstanden die Konjunkturgespräche der Deutschen
Volkwirtschaften Gesellschaft e.V. Die Konjunkturgespräche fanden auf
dem ›neutralen Boden‹ der Gesellschaft im Gürzenich in Köln statt.
Sie wurden mit führenden Vertretern aus den Wirtschafts-, Sozial- und
Gewerkschaftsverbänden sowie aus der deutschen Bundesbank durchgeführt
- und zwar 18-mal in aufeinander folgenden Jahren.
Die Gesprächsergebnisse wurden veröffentlicht bzw. Interessenten
zugänglich gemacht.
4. Die Tagungen der Deutschen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft e.V. über Themen der Wirtschafts- und Sozialpolitik mit anschließender
Veröffentlichung der Tagungsergebnisse - ebenfalls im Gürzenich.
So wurde u.a .das Erste Jahresgutachten des Sachverständigenrats 1964/65
mit mehr als 50 Teilnehmern in seinem Für und Wieder einer ausführlichen
Stellungnahme unterzogen. Die Diskussionsergebnisse wurden von mir dann redaktionell bearbeitet und von der Deutschen Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft veröffentlicht.
5. Die ›Harzburger Hefte‹ mit Veröffentlichungen aus der Arbeit der
Akademie.
Ich war vom ersten Heft an 15 Jahre lang Hauptschriftleiter, gestaltete
das Layout zusammen mit kompetenten Grafikern und war für die Auswahl
der Beiträge zuständig.
Daneben bestand meine Aufgabe als Dozent der Akademie auf den
Sachgebieten Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Menschenführung, in
der Vertragschließung mit den Gastdozenten - in der "Blütezeit" der
Akademie mit 1500 Seminaren im Jahr waren es ca. 60 Gastdozenten, in
der Vertragschließung mit Hoteliers über die Durchführung von Seminaren
in ihren Hotels in Bad Harzburg und in der Schweiz, dort im Ringhotel in
Engelberg, das ich auf einer Erkundungsreise besonders empfehlenswert
gefunden hatte.
Während der 25 Jahre meiner Arbeit war ich völlig frei in meinen
Entscheidungen.
So wie die von uns gelehrte Führung mit Delegation von Verantwortung ja
auch beinhaltet, dass der jeweilige Stelleninhaber seine Aufgaben
selbstverantwortlich im Rahmen gesetzter Ziele durchführt.
Das Gespräch ist das Führungsmittel des Vorgesetzten. In einem
Mitarbeitergespräch stellt der Vorgesetzte fest, ob der Mitarbeiter in
Übereinstimmung mit den ihm gesetzten Zielen gehandelt hat und er prüft
dabei, ob die dabei notwendigen betrieblichen Entscheidungen zu einem
erfolgreichen Ergebnis geführt haben.
Eine Kritik dieser Führungskonzeption ist deshalb eng verbunden mit der
Frage , ob die jeweiligen Stellen mit den richtigen Mitarbeitern besetzt
sind.
Meiner Einschätzung nach ist dies in der Gegenwart für alle Ebenen der
meisten Unternehmen eine berechtigte Frage.
In meinem 69. Lebensjahr wurde ich auf eigenen Wunsch
pensioniert.
Da die für mich eingerichtete betriebliche Altersversorgung zu niedrig
war, um davon leben zu können, kümmerte ich mich - nunmehr selbständig -
um andere Verdienstmöglichkeiten.
Wir verkauften unser Haus in Bad Harzburg und bauten zum zweiten Mal in Uffing am Staffelsee in Oberbayern. Dort nahm ich das Angebot der ›PAI - Planungsgruppe Architekten und Ingenieure‹ an, in dem Unternehmen beratend tätig zu sein. - Die PAI hatte auch unser Haus in Uffing gebaut.
Außerdem wurde ich nun als Freier Bildhauer tätig. Bis zum Jahre 2007 wurden von mir in mehr als 50 Ausstellungen im In- und Ausland 20 neue Skulpturen und Bronzeplastiken vorgestellt.
Weitere Beiträge...
- Die Konjunkturgespräche
Die Konjunkturgespräche der Deutschen Volkwirtschaften Gesellschaft e.V. - Die Tagungen
Die Tagungen der Deutschen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft e.V. - Die "Harzburger Hefte"
Die "Harzburger Hefte" mit Veröffentlichungen aus der Arbeit der Akademie